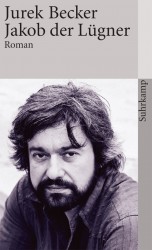Jakob der Lügner
Zusammenfassung zu “Jakob der Lügner”
Der namenlose Ich-Erzähler berichtet mehr als 20 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges über die Geschehnisse in einem unbekannten polnischen Ghetto. Mehrmals will er bereits diesen Erzählversuch gestartet haben, mehrmals missglückte er. Mit viel Alkohol und unter Zuhilfenahme von Erinnerungen und Recherchen wagt der Erzähler nun einen weiteren Versuch. Protagonist ist der Jude Jakob Heym. Er wurde im Ghetto von einem Wachposten nach der Ausgangssperre entdeckt und soll sich nun im Büro der Deutschen melden. Und während er voller Angst und Sorge wartet, hört er zufällig Gesprächsfetzen aus einem Radio. In diesem Moment beginnt der Kern der Geschichte: Die Rote Armee, so der Sprecher im Radio, soll bereits bis zur Stadt Bezanika vorgerückt sein. Die missachtete Ausgangssperre bleibt ungerügt, dafür entwickelt sich im Kopf Jakob Heyms ein unglaubliches Gedankengebilde. Bei seiner Arbeit auf einem Güterbahnhof plant Heyms Freund Mischa den Diebstahl von Kartoffeln. Heym hält Mischa im letzten Moment davon ab, indem er ihm vom Besitz eines Radios vorlügt. Mischa vergisst den Diebstahl und möchte mehr wissen. Jakob Heym erzählt ihm, dass die Russen nicht mehr weit wären. Der Besitz eines Radios steht im Ghetto jedoch unter Todesstrafe. Dennoch kann Mischa diese Neuigkeit nicht für sich behalten. Er erzählt sie seiner Freundin Rosa sowie deren Eltern, die bereits jegliche Hoffnung verloren haben. Bald wissen alle im Ghetto Bescheid. Heym erfährt nun Unterstützung bei seiner schweren körperlichen Arbeit. Doch es gibt auch einige, die das Radio kritisch betrachten. Um diesem Konflikt zu entgehen, erfindet Heym immer neue Fakten vom Vormarsch der Roten Armee. Damit spendet er Hoffnung. Die Selbstmorde im Ghetto gehen zurück. Der Ich-Erzähler bietet zwei Enden an: Einmal wird Heym wie alle anderen deportiert. Beim zweiten Ende wird Heym auf der Flucht erschossen, zugleich nähert sich bereits die Rote Armee, um das Ghetto zu befreien…
Wichtige Charaktere
- Jakob Heym
- Kowalksi
- Lina, ein Waisenkind
- Mischa, Jakobs Arbeitskollege
- Rosa Frankfurter, Mischas Freundin
Interpretation
Der Roman erschien erstmals 1969. Jurek Becker befand sich zu Kriegszeiten selbst im Ghetto in Lodz und verlor an die 20 Mitglieder seiner Familie durch die Faschisten. Mit dem Roman hat er einen Weg gefunden, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Erstaunlich, mit wie wenig Groll er dies tut. Dafür spielt die Komik eine entscheidene Rolle. Doch wieviel Witz, wieviel Lachen ist nach Ausschwitz eigentlich erlaubt? Diese Frage trieb viele damaligen Künstler um. Jurek Becker hat dies eindeutig für sich entschieden: Seiner Hauptfigur Jakob Heym gelingt es, mit seinen Notlügen den anderen Gefangenen ein Quentchen Hoffnung, ein Stück Freude in die Herzen zu zaubern. Nur mit den erfundenen Nachrichten aus dem Radio werden Selbstmorde verhindert, werden Zukunftshoffnungen geschürt. Lachen bedeutet Leben. Ein bisschen lebenswertes Leben findet mit Jakob Heym nun auch in diesem Ghetto statt, selbst, wenn ansonsten das Grauen regiert. Eine große Rolle spielt im Buch auch das Motiv des Baumes. Bereits der Ich-Erzähler vom Anfang stellte fest: Durch einen Sturz vom Baum konnte er nicht Musiker werden. Unter einem Baum wurde er zum Mann, unter einem Baum wurde seine Frau erschossen. Kein Baum darf im Ghetto stehen. Der Baum steht demnach für den Tod. Erst am Ende des Romans, als der Erzähler aus einem Zug heraus die vorbeiziehenden Bäume betrachtet, stehen diese Bäume wieder für das Leben, für die Zukunft.
Zitat
“Es hört sich seltsam an, ich habe noch nie einen einzelnen Schuss gehört, immer nur mehrere auf einmal, als ob ein ungezogenes Kind trotzig mit dem Fuß aufstampft, oder ein Luftballon wird zu heftig aufgeblasen und platzt, oder gar, wenn ich schon in Bildern schwelge, Gott hat gehustet, Gott hat Herschel eins gehustet.”
Persönliche Bewertung
Meisterhaft, wie der Jude Jakob im Ghetto lügt, um anderen Hoffnung zu spenden.
Der Roman wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Folglich ergibt sich ein umfassendes und vielschichtiges Bild über das damalige Leben in einem Ghetto. Als Leser fühlt man sich mittendrin und leidet mit. Die Sprache ist ausgefeilt und sehr poetisch. Auch in grausamen Situationen schwingt stets Komik mit (s.o.) „Jakob der Lügner“ wurde mehrfach verfilmt und gilt als eines der besten Prosabücher, welches in der DDR entstanden ist. Es sollte als Pflichtlektüre in jedem Bücherregal stehen. Abgesehen davon, dass mit dem Buch die Erinnerungen an die Schrecken der Nazi-Zeit nicht in Vergessenheit geraten, bleibt noch ein anderer Fakt nicht nebensächlich. Jurek Becker zeigt, dass man nicht in der Schuld- und Grausamkeitsfrage stecken bleiben sollte. Mit Humor lässt sich selbst Schlimmstes ertragen – und überwinden. Diesen Mut, in jeder Situation einen kleinen, lachenden Funken zu entdecken, möchte er dem Leser mit auf den Weg geben.
Fazit
Kaum ein Buch über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges kann derartige Gefühle von Schmunzeln und Lachen auslösen. Die Idee ist einzigartig: Die fiktiven Nachrichten aus einem fiktiven Radio spenden Hoffnung in einem polnischen Ghetto. Ein sehr poetisches, eindringliches Buch. Ein Meisterwerk!
- ISBN10
- 3518372742
- ISBN13
- 9783518372746
- Dt. Erstveröffentlichung
- 1969
- Taschenbuchausgabe
- 288 Seiten